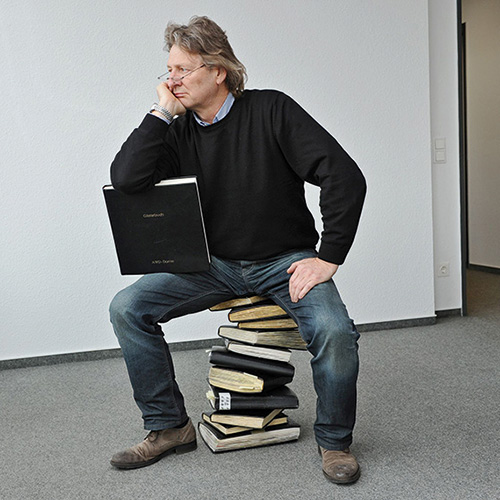Hein Mück aus Bremerhaven
Unser Kolumnist Matthias Höllings fragt sich, wer dieser Schiffsjunge eigentlich war.
Der Rattenfänger von Hameln, Antje von Gouda, die Bremer Stadtmusikanten: Sie alle haben es geschafft und werden fest mit dem jeweiligen Ortsnamen in Verbindung gebracht. Und was ist mit Bremerhaven? Wäre da nicht Hein Mück, müsste wahrscheinlich Käpt’n Iglo als Gallionsfigur für die Seestadt herhalten. Für ein normales Denkmal in Wassernähe hat es bis heute nicht gereicht, aber dieses Schicksal teilt auch Elvis Presley, dessen Landgang 1958 in Bremerhaven von seinen Fans heute noch Jahr für Jahr gefeiert wird. Doch wer war eigentlich dieser Hein Mück aus Bremerhaven, den jede und jeder zu kennen scheint? War er ein Kapitän oder Bürgermeister? Auf jeden Fall muss es ein ungewöhnlicher Typ gewesen sein, der von der Bevölkerung bis heute sehr geliebt wird. Mein Onkel hat mich als kleinen Pöks in den 1950er-Jahren auch des Öfteren so genannt, wenn ich mal wieder irgendeinen Blödsinn angestellt hatte. Obwohl in Bremerhaven geboren, habe ich diesen Spitznamen damals nicht begriffen. Für eine Märchenfigur hat es bei diesem Seemann Mück auf jeden Fall nicht gereicht, aber seine Geschichte geht Jahrzehnte zurück.
Damals, als im alten Hafen noch die imposanten Windjammer auf Reede lagen und die Seeleute und Matrosen bei ihren Landgängen ihre Heuer auf den Kopf hauten, bevor sie wieder für Monate auf See mussten, da muss dieser Hein Mück mit dabei gewesen sein. In dieser Zeit, 1901, notierte ein Kapitän namens Richard Freese, dass er sich an einen 14-jährigen, plietschen Schiffsjungen aus Bremerhaven erinnert, der auf der Dreimastbark „Hanna Hege“ anheuerte.
Dieser Junge sei immer quietschvergnügt gewesen, hätte stets gute Laune verbreitet, sei immer für einen Streich zu haben gewesen und habe die Shantys an Bord mit seinem „Quetschbüdel“ begleitet. Ein Instrument, das auch als „Quetschkommode“, „Handorgel“, „Schifferklavier“ oder als „Akkordeon“ bezeichnet wird. Der pfiffige Junge war bei der gesamten Schiffsbesatzung beliebt und wurde von allen nur Hein Mück genannt.
Was aus ihm wurde, ist nicht überliefert. Aber sein Spitzname wurde Jahre später sozusagen vererbt, denn 1914 taucht in Erzählungen erneut ein Matrose mit dem Namen Hein Mück bei der kaiserlichen Marine auf, bei dem es sich um einen springlebendigen, musikalisch begabten Schiffszimmermann handeln soll. Also erneut so ein aufgeweckter Typ mit Schifferklavier, der viel Unsinn im Sinn hatte. Ich habe mir diesen Spitznamen bei meinem Onkel scheinbar ganz ohne Akkordeon und Seefahrt erarbeitet, dafür aber mit sehr viel Unsinn.
Hein Mück war in der Bevölkerung bekannt und beliebt, da verwundert es nicht, dass in den 1930er-Jahren über so einen Bremerhavener Jung ein Schlagertext verfasst wurde, mit dem 1958 nicht Elvis, sondern die Bremerhavenerin Lale Andersen dem Schiffsjungen und Matrosen zumindest ein musikalisches Denkmal setzte. Im Text heißt es unter anderem: „Hein Mück aus Bremerhaven ist allen Mädels treu. Er hat nur eine feste Braut, doch zwanzig nebenbei.“ Und an anderer Stelle: „Er ist ein Matrose mit ’ner weiten Hose. Die Mädchen sind außer Rand und Band, seh’n sie Hein Mück von der Waterkant.“ Haben die Mädels damals wirklich Hein Mück gesehen – oder war es doch Elvis?
Weitere Beiträge